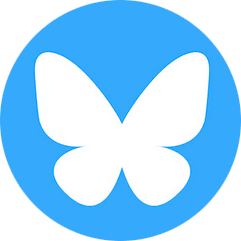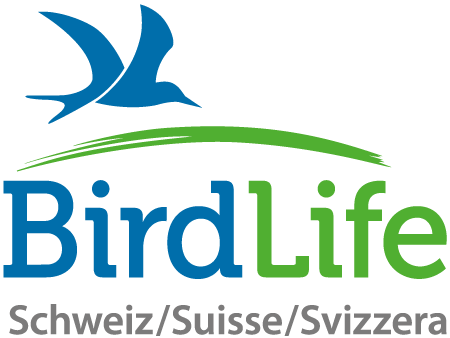BirdLife Schweiz hat die einmalige Gelegenheit, in Riehen vor den Toren Basels eine Landparzelle zu kaufen und ökologisch aufzuwerten. BirdLife hat daher ein Crowdfunding gestartet, das ein grosser Erfolg war. Ganz herzlichen Dank an alle Spender/innen!
Aktuell: Nach kurzer Zeit haben wir das Sammelziel bereits erreicht! Dass Sie sich so grossartig an der Finanzierung dieses einmaligen Renaturierungsprojekts im Schlipf beteiligen, hat selbst unsere hoffnungsvollsten Prognosen übertroffen. Nun können wir die Vorhaben umsetzen und sogar noch weiterdenken! Wir danken von Herzen!
Film zum Projekt
Worum geht es in diesem Projekt?
BirdLife Schweiz hat die einmalige Gelegenheit, in Riehen vor den Toren Basels eine Landparzelle zu kaufen und ökologisch aufzuwerten. Im Schlipf, zwischen Familiengärten und Rebparzellen, besteht damit die Chance, den bereits bestehenden Wiedehopfgarten des lokalen BirdLife-Naturschutzvereins zu vergrössern. Die Parzelle eignet sich sehr für das Anlegen von Kleinstrukturen für Reptilien und Insekten, Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse und Massnahmen für viele weitere Tiere und Pflanzen. Als natürlicher Lebens- und Ruheraum wäre das ein wichtiger Trittstein für die Biodiversität dieser Region.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?
Mit dem Projekt sollen Arten wie der Gartenrotschwanz oder der Wendehals, die bereits in der Gegend brüten, weiter unterstützt werden. Auch seltene Fledermausarten wie das Graue Mausohr profitieren: In der Gemeinde Riehen kann dank alter Gebäudebestände wie der Kirche diese in der Schweiz vom Aussterben bedrohte Art zwar gesichtet werden. Sie ist aber dringend auf weitere Nist- und Ruheplätze angewiesen. Mit Unterschlüpfen im bestehenden Gerätehäuschen können wir sie fördern. Die Schlingnatter ist bereits im Wiedehopfgarten eingezogen. Die Erweiterung ihres Lebensraums ist ein besonders wichtiges Anliegen. Zu weiteren Zielarten gehören auch die Langhornbienen, eine von zahlreichen Wildbienenarten der Region, die dringend auf Nahrung und Nistplätze angewiesen sind. Und selbst der Igel braucht Hilfe. Sein Bestand nimmt stetig ab. Mit geeigneten Kleinstrukturen können wir ihm ein Zuhause schaffen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen?
Eine Parzelle im Schlipf erwerben und für eine lange Zukunft für die Natur erhalten zu können, ist eine einmalige Chance. Dass wir damit den Wiedehopfgarten (Pachtland von der Gemeinde) erweitern können, ist ein besonderer Glücksfall. Im Wiedehopfgarten stehen gerade weitere Aufwertungsmassnahmen an. So haben wir die Baugenehmigung für eine Trockensteinmauer zur Hangsicherung erhalten. Diese könnte mit dem Kauf der Parzelle um weitere 8 Meter verlängert werden. Das Flurstück besticht auch durch einen alten Baumbestand, den es zu erhalten gilt, und hat sogar Zugang zu einem kleinen Quellbach, der weitere Aufwertungsmassnahmen ermöglich.
Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung?
Die Parzelle stammt aus Privatbesitz. Die hohe Nachfrage nach den Parzellen im Schlipf wirkt sich leider auch auf den Preis aus. So wird rund die Hälfte der gesammelten Gelder für den Kauf eingesetzt werden müssen. Dies ist durch die langfristige Sicherung des Landes für die Natur und die besonders sinnvolle Erweiterung des Wiedehopfgartens gerechtfertigt.
In einer ersten Phase müssen auf der Parzelle durch die Entfernung der Neophyten und die Renaturierung der bestehenden Wiese und Hecken die Nahrungsbedingungen für die Zielarten geschaffen werden. Dann ist die Anlage der Trockensteinmauer, die Erweiterung des Hochstammobstgartens und die Anlage von Kleinstrukturen wie Stein-und Asthaufen sowie die Aufwertung des Geräteschuppens als Unterschlupf, Nist- und Rückzugsort für Fledermäuse Vögel und Kleinsäuger geplant.

Wer steht hinter dem Projekt?
Verantwortlich für die Durchführung des Projektes und die Verwaltung der Finanzen ist BirdLife Schweiz. Projektpartner vor Ort ist die Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Riehen (GVVR). Sie hat auch den Wiedhopfgarten aufgebaut und ist für dessen Pflege verantwortlich. Das Projekt liegt zudem im Perimeter des Trinationalen BirdLife-Steinkauzförderprojekts, mit dem BirdLife Schweiz zusammen mit Partnern seit 25 Jahren erfolgreich Artenförderung betreibt und unzählige Grundstücke zugunsten der Biodiversität aufwertet.
Artenportraits

Lebensraum:
Der Europäische Igel ist in weiten Teilen Europas verbreitet und lebt bevorzugt in Gärten, Parks, Heckenlandschaften, Waldrändern und naturnahen Siedlungsgebieten. Er braucht strukturreiche Lebensräume mit Versteckmöglichkeiten wie Laubhaufen, Gebüschen oder Totholz.
Nahrung & Vorlieben:
Igel leben als Einzelgänger. Sie sind Insektenfresser und hauptsächlich nachtaktiv. Sie ernähren sich bevorzugt von Insekten wie Laufkäfern, Ohrwürmern und Tausendfüsslern und alle Arten von Insektenlarven, diese sind proteinreich und leicht zu finden. Würmer und Schnecken werden gefressen, wenn die bevorzugte Nahrung knapp ist. Sie können Parasitenträger von Lungen- und Darmwürmern sein und sollten daher nicht aktiv an Igel verfüttert werden. Igel fressen weder Obst noch Gemüse.
Die Hauptfortpflanzungszeit des sympathischen Säugetieres liegt zwischen Juni und August. Die Jungtiere werden von der Mutter während 42 Tagen gesäugt. Danach sind die Jungen auf sich selbst gestellt.
Bedrohung der Art:
- Lebensraumverlust: Durch intensive Landwirtschaft, sterile Gärten und Flächenversiegelung verschwinden natürliche Lebensräume.
- Straßenverkehr: Viele Igel sterben beim Überqueren von Straßen.
- Pestizide: Vernichten Nahrungsquellen (Insekten) oder vergiften die Tiere indirekt, z. B. durch den Frass von vergifteten Schnecken.
- Mähroboter & Gartengeräte: Können Igel schwer verletzen oder töten.
Obwohl der Igel in vielen Regionen noch verbreitet ist, gilt er in einigen Ländern wie z. B. der Schweiz bereits als gefährdet.
Fun Facts:
- Igel haben etwa 6.000 bis 8.000 Stacheln, die alle einzeln in kleinen Muskeln sitzen.
- Bei Gefahr rollen sie sich zu einer stacheligen Kugel zusammen.
- Im Winter halten Igel Winterschlaf, bei dem ihre Körpertemperatur stark absinkt und sie 20 bis 40 % ihre Körpergewichts verlieren. Daher ist es so wichtig, dass Igel gut genährt in die Winterruhe starten können.
- Igel können sehr gut hören und riechen, aber schlecht sehen.
- Igeljunge haben bei der Geburt ca. 100 Stacheln. Ihre Augen und Ohren sind geschlossen und öffnen sich erst nach 14 Tagen.

Lebensraum:
Der Wiedehopf bevorzugt warme, offene Landschaften mit wenig Bewuchs, z. B. Streuobstwiesen, Weinberge, lichte Wälder, Weiden oder trockene Graslandschaften. Er braucht alte Bäume, Mauern oder Nischen zum Brüten – oft nutzt er verlassene Spechthöhlen oder Nistkästen.
Er ist ein Zugvogel und verbringt den Winter in Afrika südlich der Sahara.
Nahrung & Vorlieben:
Der Wiedehopf ernährt sich hauptsächlich von Gross-Insekten (besonders Engerlinge, Käfer, Grillen), Larven, Spinnen und gelegentlich kleine Reptilien oder Amphibien gehören ebenfalls auf den Speiseplan.
Er sucht seine Beute am Boden und stochert mit seinem langen, gebogenen Schnabel nach Insekten. Um die Insekten zu entdecken und jagen zu können ist er auf lückigen Bewuchs angewiesen,
Bedrohung der Art:
In den 1960er Jahren war der Vogel in der Schweiz noch häufig anzutreffen. Seither ist sein Bestand kontinuierlich zurückgegangen. Heute ist er noch im Genferseebecken oder am Jurasüdfuss, ebenso in grösseren Alpentälern im Graubünden und Tessin anzutreffen. Vereinzelte Bruten sind in der Nordwestschweiz festgestellt worden. In der Schweiz ist der Wiedehopf auf der Roten Liste als verletzlich eingestuft. Die Art ist vornehmlich durch folgende Faktoren bedroht:
- Lebensraumverlust: Durch intensive Landwirtschaft und das Entfernen alter Bäume fehlen Brutplätze und Nahrungsflächen.
- Pestizide: Reduzieren das Nahrungsangebot massiv.
- Klimawandel: Beeinflusst Zugverhalten und Bruterfolg.
Fun Facts:
- Der Wiedehopf ist leicht erkennbar an seiner auffälligen Federhaube, die er bei Aufregung aufstellt.
- Sein Ruf klingt wie „up-up-up“ – daher der wissenschaftliche Name Upupa epops.
- Bei Gefahr können Jungvögel und Weibchen ein stinkendes Sekret aus der Bürzeldrüse absondern – zur Feindabwehr.
- Der Wiedehopf kann bei der Nahrungssuche mit dem Schnabel unterirdisch lebende Larven aufspüren – ähnlich wie ein Specht auf dem Boden.
Weitere Informationen

Lebensraum:
Der Gartenrotschwanz lebt bevorzugt in lichten Wäldern, Streuobstwiesen, Parks und gärtenreichen Dörfern mit alten Bäumen. Wichtig sind höhlenreiche (eben daher alte) Bäume oder Nistkästen für die Brut.
Im Herbst zieht er als Langstreckenzieher nach Afrika südlich der Sahara – seine Reise ist über 5.000 km lang!
Nahrung & Vorlieben:
Der Gartenrotschwanz ernährt sich hauptsächlich von Insekten und Spinnen. Im Herbst frisst er zusätzlich auch Beeren (z. B. Holunder oder Vogelbeere), um Energiereserven für den Zug aufzubauen.
Bedrohung der Art:
- Lebensraumverlust: Durch den Rückgang alter Bäume und Streuobstwiesen.
- Intensive Landwirtschaft: Führt zu Insektenmangel.
- Fehlende Nistplätze: In modernen Gärten und Siedlungen gibt es oft keine geeigneten Höhlen oder Nistplätze.
- Klimawandel: Beeinflusst Zugzeiten und Nahrungsverfügbarkeit.
In der Schweiz ist der Gartenrotschwanz als potenziell gefährdet eingestuft.
Fun Facts:
- Männchen sind besonders auffällig: mit orangeroter Brust, schwarzem Gesicht und grauem Kopf sind sie besonders attraktiv.
- Er wippt oft mit dem rostroten Schwanz – daher der Name Rotschwanz.
- Gartenrotschwänze brüten oft in alten Spechthöhlen oder Nistkästen – sind also sehr gute „Untermieter“.
- Er singt gern von erhöhten Sitzwarten (z. B. Zaunpfählen oder Baumspitzen) und hat einen melodischen, flötenden Gesang.
- Die Art zeigt hohe Standorttreue – viele kehren jedes Jahr an denselben Brutplatz zurück.
Weitere Informationen

Lebensraum:
Das Graue Langohr ist eine nachtaktive Fledermausart, die in weiten Teilen Europas vorkommt. Diese Art ist ein strikter Gebäudebewohner bevorzugt strukturreiche Kulturlandschaften, z. B. Dörfer mit alten Gebäuden, Streuobstwiesen, Parks und Waldränder. Tagsüber versteckt es sich in Dachböden, Mauerritzen oder Kirchtürmen in Kolonien von 20 bis 60 Tieren.
Nahrung & Vorlieben:
Das Graue Langohr jagt meist im langsamen Flug. Dabei nutzt es vor allem sein gutes Gehör – es lauscht auf Geräusche von Beutetieren. Diese findet die Fledermaus im Tiefflug über artenreichem, extensiv genutztem Offenland knapp über der Vegetation, oder über Baumkronen. Die Beute besteht hauptsächlich aus Nachtfaltern, saisonal aber auch aus fliegenden Käfern bis zur Grösse von Maikäfern. Die Jagdgebiete liegen meist in weniger als 5 km Entfernung zum Nachtquartier. Die Art ist auf dunkle Flugkorridore als Verbindung des Quartiers mit den Jagdgebieten angewiesen.
Bedrohung der Art:
Das Graue Langohr ist in der Schweiz vom Aussterben bedroht, sie kommt aber in Riehen vor und kann regelmässig im Schlipf beobachtet werden. Die Art ist vornehmlich durch folgende Faktoren bedroht:
- Verlust von Quartieren: Sanierungen alter Gebäude oder das Verschließen von Dachböden nehmen den Tieren Unterschlupfmöglichkeiten.
- Pestizideinsatz: Verringert das Nahrungsangebot drastisch.
- Lichtverschmutzung: Stört das Jagdverhalten.
- Intensive Landwirtschaft: Vernichtet strukturreiche Lebensräume.
Fun Facts:
- Die Ohren sind fast so lang wie der Körper (bis zu 4 cm) – sie werden beim Ruhen oft unter die Flügel eingeklappt.
- Es fliegt besonders langsam und wendig, fast schwebend – perfekt für die Jagd in dichter Vegetation.
- Graue Langohren rufen sehr leise, ihre Ortungslaute sind für Menschen oft gar nicht hörbar.
- Sie können bis zu 30 Jahre alt werden – für ein so kleines Säugetier erstaunlich viel.
- Im Winter halten sie Winterschlaf in kühlen, feuchten Verstecken, z. B. Kellern oder Stollen.

Lebensraum:
Langhornbienen kommen vor allem in sonnigen, offenen Lebensräumen vor, beispielswiese in Trocken- oder Streuobstwiesen, Böschungen und Sand- oder Lehmgruben.
Sie brauchen blütenreiche Flächen und offene Bodenstellen für ihre Nester, die sie selbst graben. Besonders wichtig: ungepflegte, naturnahe Wiesen.
Nahrung & Vorlieben:
Mit ihren langen Fühlern und dem pelzigen Rücken ist die Langhornbiene auch für Menschen mit wenig Bienenkenntnis gut erkennbar. Sie gehört zu den Spezialisten unter den Wildbienen und hat sich auf Schmetterlingsblütler spezialisiert.
Bedrohung der Art:
- Lebensraumverlust: Durch intensive Landwirtschaft, Versiegelung und häufiges Mähen verschwinden geeignete Blühflächen und Nistplätze.
- Pestizide: Schädigen Bienen direkt oder entziehen ihnen die Nahrungsgrundlage.
- Blumenarme Gärten & Flächen: Kurzrasen und sterile Flächen bieten keinen Lebensraum.
- In der Schweiz leben 12 Langhornbienenarten. Gelten als gefährdet, einige sogar als stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht.
Fun Facts:
- Die Männchen haben extrem lange Fühler – daher der Name Langhornbiene. Sie nutzen sie zur Partnersuche, z. B. um Weibchen zu erschnuppern.
- Anders als Honigbienen leben sie nicht in Völkern, sondern solitär – jedes Weibchen gräbt für die Nester seiner Larven eigene Gänge in sandigen oder lehmigen Boden.
- Besondere Abhängigkeit: Die Blüten der Hummel-Ragwurz ahmen Form und Duft eines Langhornbienen-Weibchens nach und locken so die Langhornbienen-Männchen an. Bei der vermeintlichen Begattung einer Blüte, nimmt das Bienenmännchen Pollen auf. Auf der nächsten Orchidee, streift es die Pollen auf die Narbe der Hummel-Ragwurz und hat damit ungewollt als «Pollentaxi» zur Bestäubung beigetragen. Ohne Langhornbiene wäre das Überleben der Hummel-Ragwurz nicht möglich.

Lebensraum:
Die Schlingnatter lebt in trockenen, sonnigen und strukturreichen Lebensräumen, z. B.: Heiden und Magerrasen, an Waldrändern, Bahntrassen, Steinbrüchen und Trockenmauern. Sie liebt wärmebegünstigte Standorte mit vielen Verstecken wie Steinen, Totholz oder dichter Vegetation.
Nahrung & Vorlieben:
Die Schlingnatter ist die kleinste in der Schweiz heimische Schlangenart. Sie ist eine ungiftige Würgeschlange, die ihre Beute mit Körperschlingen festhält und erdrosselt. Vornehmlich jagt sie Eidechsen, Blindschleichen, andere kleine Schlangen sogar Artgenossen, gelegentlich auch Kleinsäuger oder Jungvögel
Sie jagt tagsüber und setzt stark auf Tarnung und Geduld. Sie bewegt sich langsam fort und ist dadurch auch im trockenen Laub nicht hörbar. Ihre heimliche Lebensweise führt dazu, dass man sie kaum achtet. Dies ist auch ihr bester Schutz vor dem Gefressen werden. Ihre Hauptfeinde sind Greifvögel und Marder, im Siedlungsgebiet auch Hauskatzen.
Bedrohung der Art:
- Lebensraumverlust: Durch Bebauung, intensive Landwirtschaft und Aufforstung verschwinden ihre bevorzugten Lebensräume.
- Zerschneidung der Lebensräume: Straßen und Wege verhindern Wanderungen und Austausch zwischen Populationen.
- Störungen durch Menschen: Sie wird oft mit der Kreuzotter verwechselt und aus Angst getötet, obwohl sie völlig harmlos ist.
Jura, Alpen und Alpensüdseite beherbergen noch intakte Schlingnatterbestände. Im Mittelland ist die Art in den letzten 50 Jahren stark zurückgegangen und regional bereits ausgestorben. Die Schlingnatter ist in der Schweiz stark gefährdet. Im Wiedehopfgarten konnte sie in den vergangen zwei Jahren beobachtet werden. Letztes Jahr gab es Nachwuchs.
Fun Facts:
- Sie ist meisterhaft getarnt: Durch ihre braun-graue Färbung und das schmale Muster ist sie kaum zu erkennen.
- Trotz ihres gefährlich klingenden Namens ist sie völlig ungiftig und ungefährlich für Menschen.
- Wird sie gestört, kann sie in äusserster Not auch zubeissen.
- Sie erreicht eine Länge von etwa 60 bis 70 cm – also eher klein.
- Sie ist ein echter Sonnenliebhaber – häufig sieht man sie sich auf warmen Steinen aufwärmen.